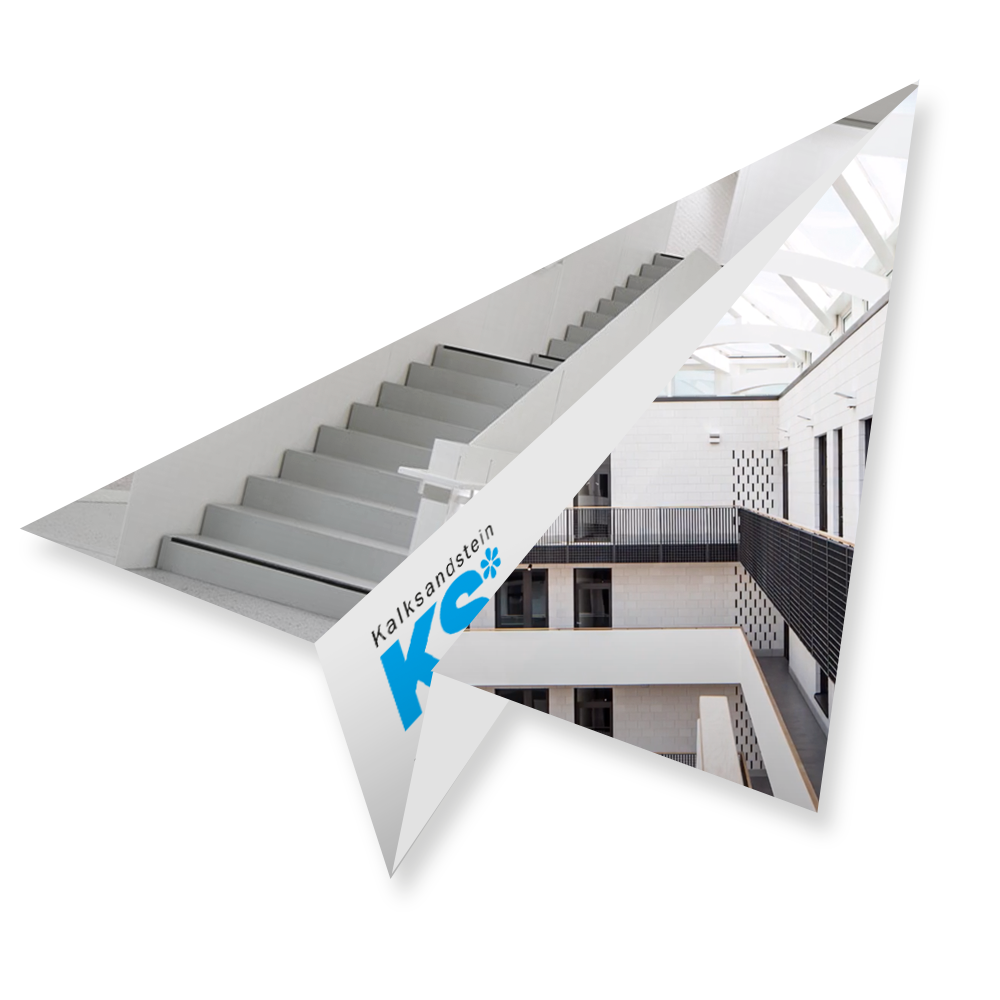Welche Rolle spielt die Stadt Bremen mit ihrer sehr eigenen Kultur und Architektur für das Büro?
Dadurch, dass es ein Stadt-Staat ist, und ein kleiner dazu, sind die Wege relativ kurz und man kann alles schnell mit allen beteiligten Akteur*innen diskutieren. Das bringt eine persönliche Ebene in die Vorhaben und man sieht, dass viele, auch in den Behörden und bei Projektentwicklern, für Ideen jenseits der Norm brennen. Gerade in den Behörden gibt es hier ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität und eine Leidenschaft für die Weiterentwicklung der Stadt.
Gibt es einen hanseatischen Blick auf das Bauen?
Für uns bedeutet dieser hanseatische Blick ein fast schon pathologisches Understatement. Das kann oft dazu führen, dass es einen Willen zum Unbesonderen gibt, man will explizit nicht mit irgendwas auftrumpfen. Wir finden das schade, weil wir der Meinung sind, dass eine Stadt von besonderen Bausteinen und eben auch von architektonischen Denkmälern lebt, die sich Leute im Zweifelsfall selbst setzen. Venedig wäre ja beispielsweise auch nicht dieser besondere Ort, wen dort nicht alle Lust gehabt hätten, tolle Häuser zu bauen, mit denen sie sich identifizieren und mit anderen in Konkurrenz treten können.
Sehen Sie sich als junge Architekten in einer Verantwortung, die über das Bauen von ästhetisch und funktional überzeugenden Gebäuden hinausreicht?
Ehrlich gesagt sind ja schon Ästhetik und Funktionalität keine Selbstläufer, sondern eine Baustelle, an der wir gemeinsam weiterarbeiten müssen. In den letzten 50 bis 70 Jahren ist eigentlich konsequent die falsche Stadt gebaut worden. Autogerechtigkeit und die räumliche Trennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit – das ist wirklich kein Weg, der langfristig gute und weiterentwickelbare Städte produziert, das dürfte inzwischen jedem klar sein. Wir sind der Meinung, dass unsere gesamte Generation da eine wichtige Aufgabe hat.
(Wie) hat die Corona-Pandemie ihre Arbeit beeinflusst?
Die Arbeitsweise eigentlich kaum – abgesehen davon, dass wir viel mit Maske gearbeitet haben. Aber das Aufgabenfeld hat sich schon gewandelt. Die Thematik der Weiterentwicklung bzw. des Umbaus der Innenstädte wurde katalysiert. Dadurch haben sich ein paar temporäre Projekte, auch in der Bremer Innenstadt, ergeben, die beispielsweise der Frage nachgehen, welche Aufgabe ein Stadtkern noch für die Gesamtstadt haben kann, wenn sich alles wandelt. Diese experimentellen Arbeiten zu Innenstädten beschäftigen uns inzwischen sehr, zum Beispiel im Rahmen der Projektgruppe „Cesam58“, die die Aktivierung und Entwicklung von C-Lagen in der Bremer City voranbringen will.
Was verstehen Sie unter „einfachem Bauen“?
Für uns ist das fast so eine Art Wunsch. Einfachheit ist ja auch ein Thema von Nachhaltigkeit. Und die wird im Moment noch oft mit unheimlich viel Technik realisiert. Wir finden es erstrebenswert, Nachhaltigkeit auch mit wenigen Mitteln – im Sinne von Lowtech – erreichen zu können. Das ist natürlich nicht so trivial wie es klingt, aber letzten Endes sehr viel nachhaltiger, als wenn man nach 20 Jahren den Fehlerspeicher der Heizung nicht mehr auslesen kann und daraufhin das ganze System infrage stellen muss. Neben der Haustechnik geht es dabei aber auch Materialien und Materialverbünde. Der Verzicht auf hochkomplexe Verbundwerkstoffe, bei denen man nichts mehr recyceln kann, weil alles so zusammengeklebt ist, dass man nur noch einen Haufen Sondermüll hat – auch das ist für uns auch eine Form von Einfachheit.